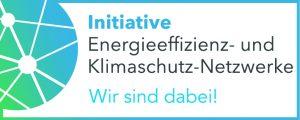Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg unterstützt Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Klimaneutralität – Beratungsstelle bei der Klimaschutz- u. Energieagentur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg eingerichtet
Tuttlingen (07.04.2022)
Das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg sieht vor, im „Musterländle“ bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Fünf Jahre früher als die Zielvorgabe des Bundes.
Wesentlich, um die Vorgabe erfüllen zu können, ist die Reduzierung der CO2 Emissionen im Wärmesektor.
Kommunal aufgestellte Wärmepläne helfen dabei, Potentiale zu ermitteln und das Vorgehen koordiniert umzusetzen.
Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohner:innen sind hierzu vom Land Baden-Württemberg verpflichtet, kleinere Kommunen können dies freiwillig tun. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind die Kreisstädte Rottweil, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen sowie Schramberg und Donaueschingen verpflichtet bis zum 31.12.2023 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen.
Das Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg unterstützt die Kommunen dabei finanziell und mit Beratung.
Die Klimaschutz- u. Energieagentur der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hat hierfür die „Beratungsstelle Kommunale Wärmeplanung“ eingerichtet und ist Ansprechpartner für interessierte Kommunen, Energieversorger, Planer und Einwohner:innen.
„Die Beratungsstelle informiert über das richtige Vorgehen bei Wärmeplanung,“ sagt Tobias Bacher, Geschäftsführer der Klimaschutz- u. Energieagentur. „Energiesicherheit, Standortvorteile und finanzierbare Wärme sind neue Herausforderungen, denen sich die Kommunen stellen müssen.“, so Bacher weiter.
Um die vielfältigen Planungsbedarfe auf kommunaler Ebene im Blick zu haben und die Kommunen bestmöglich zu unterstützen, hat sich die Klimaschutz- u. Energieagentur SBH mit der Bodensee-Stiftung aus Radolfzell zusammengetan.
Die erprobte Kooperation hat sich bereits in Projekten wie „Effiziente Wärmenetze Baden-Württemberg“ oder dem aktuellen Projekt „PV-Netzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg“ bewährt.
Für Dimitri Vedel, Projektleiter der Bodensee-Stiftung stellt die Kooperation ein Mehrgewinn für die Kommunen dar. „Mit der Klimaschutz- u. Energieagentur können, im Zusammenspiel mit der Bodensee-Stiftung, Strategien zur Reduzierung des Endenergiebedarfs und eines effizienten und nachhaltigen Einsatz von erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung in Kommunen umfassend ausgearbeitet werden,“ erklärt Dimitri Vedel.
Die Einbindung erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme zum Beispiel aus Abwasser, Gewerbe und Industrie sind Wärmequellen, die zur Wärmeversorgung mit beitragen können. Die räumliche Abstimmung für die Erschließung von Wärmequellen, die damit verbundenen Infrastrukturen und die Identifizierung von Wärmesenken leistet die kommunale Wärmeplanung.
Das dreijährige, unabhängige Förderprojekt des Umweltministeriums Baden-Württemberg zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wird in Veranstaltungen, Beratungen oder Exkursionen darauf eingehen. Ziel ist es möglichst viele Kommunen, für eine Wärmepumpe zu begeistern und bei der Umsetzung zu unterstützen.
Das Land Baden-Württemberg hat ein Ziel.
Es will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden.
Das bedeutet: Es soll fast kein schädliches CO₂ mehr entstehen.
Dafür ist besonders wichtig: Weniger CO₂ beim Heizen von Gebäuden.
Große Städte müssen einen Wärme-Plan machen.
Das hilft beim Klimaschutz.
Kleine Städte dürfen freiwillig mitmachen.
In unserer Region sind diese Städte dabei:
Rottweil, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen, Schramberg und Donaueschingen.
Sie müssen den Plan bis Ende 2023 fertigstellen.
Das Land hilft mit Geld und Beratung.
Es gibt eine Beratungs-Stelle in der Region.
Sie heißt: Beratungsstelle Kommunale Wärmeplanung.
Dort gibt es Hilfe für Städte, Energie-Firmen, Planer und Bürgerinnen und Bürger.
Die Stelle erklärt, wie ein Wärme-Plan gut gemacht wird.
Die Energie-Agentur arbeitet mit der Bodensee-Stiftung zusammen.
Die beiden Partner haben schon gute Projekte gemacht.
Zum Beispiel das Projekt „Effiziente Wärmenetze Baden-Württemberg“.
Oder das Projekt „PV-Netzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg“.
Ein Mitarbeiter der Bodensee-Stiftung heißt Dimitri Vedel.
Er sagt: Die Zusammenarbeit bringt viele Vorteile für Städte.
Zusammen finden sie gute Ideen zum Heizen mit weniger Energie.
Zum Beispiel mit Sonnen-Energie oder mit Abwärme.
Auch Abwasser und Fabriken geben Wärme ab.
Der Wärme-Plan zeigt:
Wo kommt die Wärme her?
Wo wird sie gebraucht?
Dann kann man Leitungen und Technik gut planen.
Das Projekt dauert 3 Jahre.
Es ist unabhängig und gehört keiner Firma.
Es gibt Treffen, Beratungen und Besichtigungen.
Das Ziel: Viele Städte sollen mitmachen.
Und sie sollen lernen, wie man gut mit Wärme umgeht.